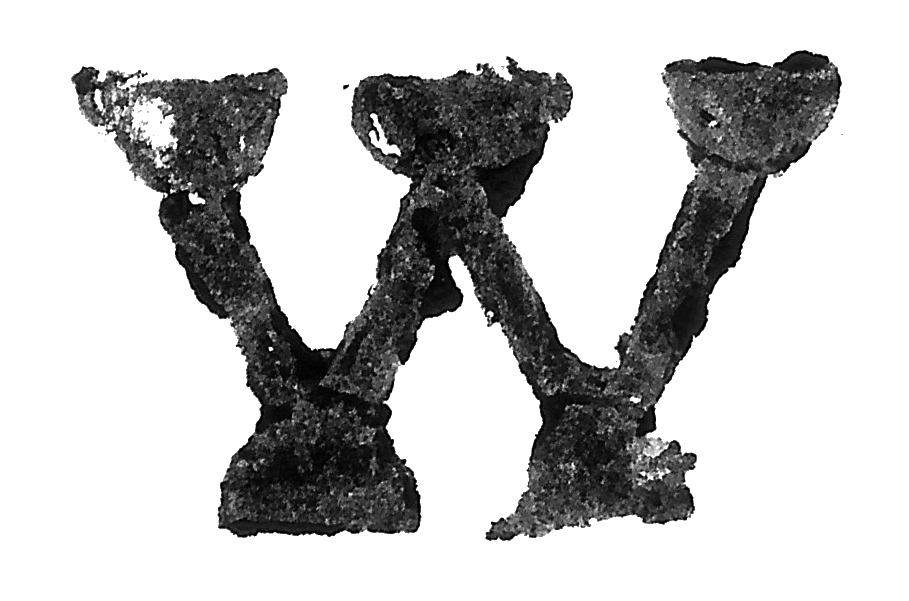Das Anekdoten-Archiv - Teil 3: Zeug*innenschaft für einen solidarischen Literaturbetrieb
Wepsert hat eine neue Gastartikelreihe! Die beiden Autor*innen Lilian Peter und Alexander Graeff haben sich mit Fragen rund um den (un-)solidarischen Literaturbetrieb beschäftigt, damit, welches subversive Potential Anekdoten als literarische Form haben und damit, welche Möglichkeiten es gibt, wie sich Autor*innen und andere Teilnehmende des Literaturbetriebs verorten und verhalten können, um ihn solidarischer zu machen.
Das Gespräch soll zu mehr Solidarität unter Kolleg*innen aufrufen. Das Anekdotenarchiv wird eröffnet. Am Ende dieses Gesprächs findet ihr den Link zu einem Padlet, in das ihr eure eigenen Anekdoten eintragen könnt, vielleicht können so Veränderungen in den Strukturen des Betriebs möglich sein?
Hier kommt Teil 3 des Gespräches:
Alexander: Okay, du saugst die Anekdoten nur so auf, ich neige zur Verdrängung. Woran liegt unser unterschiedlicher Umgang? An geschlechtsspezifischer Erziehung? Jungs sollen den Körperpanzer ausbilden, Mädchen offen sein wie Container? Wobei ich es auch kenne, wenn es tagsüber zwischenmenschlich schwierig war, dass ich abends im Bett grüble. Davon träume auch ich schlecht oder kann nicht einschlafen, weil ich denke, ich hätte was anderes sagen oder tun müssen, oder ich frage mich immerzu, warum verdammt nochmal im Literaturbetrieb keine Solidarität möglich ist. Das geht mir vor allem bei Personen so, die mir persönlich was bedeuten, bei denen ich dachte, wir sind befreundet, und die dann ihr “wahres” Gesicht zeigen.
Lilian: Ja, sehr gute Frage. Woran liegt das? Das lässt sich sicherlich nicht einfach beantworten, aber ich kenne das als Selbstbeschreibung schon auch von vielen anderen, insbesondere von Frauen. Ist ja durchaus auch ein uraltes Muster: Der “weibliche Körper” als Container oder Medium. Ich habe mal in der Redaktion einer großen Kulturzeitschrift gearbeitet, ursprünglich kam das zustande, weil ich dort einen Text veröffentlicht hatte. Dann kam ich nach Berlin, brauchte Geld, und die hatten zufällig gerade eine Stelle frei für Sekretariatsarbeiten auf Honorarbasis. Die Redaktion bestand aus vielleicht zehn Leuten. Ich saß mit im Zimmer des Herausgebers, der die Zeitschrift auch gegründet hatte. Es fing schon damit an, dass er für mich keinen Namen hatte: Mal nannte er mich Liliane, mal Lilli-Ann, mal Liane. Alle anderen waren per Du, mir wurde das Du nie angeboten. Hätte ich ihn mit “Sie” und “Herr XYZ” angesprochen, wäre das aber auch komisch gewesen, schließlich sprach er mich mit wechselnden Vornamen an, und mal mit Sie, mal mit Du. Ich vermied es also, ihn überhaupt anzusprechen. Klischeehafter, aber eben auch vielsagender geht es fast nicht. Er textete mich eigentlich den ganzen Tag zu, ich war wie ein Mülleimer für seine Geschichten. Den ganzen Tag lästerte er über die anderen aus der Redaktion. Antwort brauchte und wollte er keine. Wenn ich zu einer Antwort anhob, war er längst mit etwas anderem beschäftigt. Ich wartete nur darauf, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem auch ich “dran” wäre – und natürlich kam dieser Tag auch. Ich könnte noch viel erzählen zu diesem furchtbaren Arbeitsverhältnis, das würde jetzt aber zu lange dauern. Der einzige Ausweg bestand darin, dass ich, als ich eben “dran” war und er überhaupt nicht mehr aufhörte, mich zu beballern – und er hat mich wirklich angebrüllt – meine Sachen packte, Tschüss sagte und ging. Das war traurig, da ich viele Ideen hatte für die Zeitschrift und dort gern richtig mitgearbeitet hätte. Er hat mich aber nie wirklich mitmachen lassen. Zum Beispiel sollte ich mich auch, als Redaktionssitzung war, in die Küche setzen. Alle anderen saßen im Chefzimmer um seinen großen Tisch herum, und ich saß in der Küche und wartete zwei Stunden, bis die Sitzung vorbei war. An einem meiner letzten Tage lud er einen Studenten, der ein paar Wochen lang Praktikum in der Redaktion gemacht hatte (und der natürlich auch bei der Redaktionssitzung dabei sein durfte), zu sich an den Tisch, um mit ihm mal zu besprechen, wie eine zukünftige Zusammenarbeit aussehen könnte – während ich in der hinteren Ecke des Zimmers saß und der Chef so tat, als gäbe es mich gar nicht. Es gibt Dynamiken, die einfach auf eine Weise hierarchisch und ausschließend und/oder misogyn funktionieren, dass es unmöglich ist, das von innen heraus zu ändern. Man kann dann nur die Dynamik als solche verlassen. Ich denke, dass bestimmte Körper tatsächlich anfälliger dafür sind, als Container zu fungieren, weil sie vielleicht auch weniger gut gelernt haben, ihre Grenzen zu kennen und zu ziehen, selbst machtvoll aufzutreten. Und weil machtvolles Auftreten bei ihnen auch weniger akzeptiert ist und heiklere Folgen haben kann. Insofern, ja, wahrscheinlich hat es mit Erziehung oder Sozialisation zu tun. Vielleicht hat es aber tatsächlich zumindest auch mit konkreter Körpererfahrung zu tun. Die durch Heteronormativität grundierte Männer-Angst vor dem Eindringen in den eigenen Körper kommt ja nicht von ungefähr. Ich denke, die Erfahrung der Durchlässigkeit und Angreifbarkeit der eigenen Körpergrenzen lässt eine Person schon sehr fundamental anders in der Welt sein. Wie ist deine Einschätzung, deine Erfahrung als queere Person, die ja zugleich, wenn ich recht im Bilde bin, sehr “männersozialisiert” ist?
(c) privat
Alexander: Nur meine Familiensozialisation war stark männlich dominiert. Ich war umgeben von einem Überpatriarchen, meinem Opa väterlicherseits, meinem Vater, der etwas weniger toxisch war als sein Vater, und einem Zwillingsbruder, der noch heftiger an diesen Strukturen gelitten hat als ich. Meine Mutter und meine Oma taten mir oft Leid. Frauen wurden kaum als handelnde Subjekte betrachtet. Sicher, sie bereiteten zuverlässig das Essen zu, wuschen die Wäsche, putzten die Wohnungen und schenkten lächelnd Riesling nach. Da, wo ich großgeworden bin, waren Frauen aber bloß Zeuginnen männlicher Lebensziele. Sie galten als Projekte, die im Leben organisiert werden mussten, oder als Probleme, die die Männer zu lösen hatten.
In meiner Kindheit gab es ein skurriles Spiel. Die Kinder der Nachbarschaft trennten sich in zwei Gruppen auf, in Jungs und Mädchen. Die Jungs hatten die Mädchen zu jagen und zu versuchen, ihnen Hagebuttensamen in die T-Shirts zu stecken. Das ist nämlich Juckpulver. Die Rollen des Spiels waren wie die unseres Alltags klar verteilt. Die Jungs waren die Jäger, die Mädchen die Beute. Jungs mussten geschickt mit Hagebuttensamen umgehen und schnell laufen können. An den Mädchen war es, laut zu schreien und noch schneller zu laufen.
Lilian: Das Spiel gab es bei uns auch.
Alexander: Ich fragte meine Oma, ob ich auch den Jungs die Hagebuttensamen ins T-Shirt stecken dürfe. Sie war eigenartig berührt durch meine Frage und sagte nur sowas wie “Das geht doch nicht”. Ich verstand nicht, warum ich den Samen nur in die T-Shirts der Mädchen stecken und warum ich umgekehrt keine Beute sein durfte, in die man seinen Samen steckt. Damals begann ein stetig wachsendes Bedürfnis, meine Körpergrenzen auszuweiten und die Welt in mich hinein zu lassen. Meine Jugendsozialisation war dann ganz anders als meine Familiensozialisation. Ich hatte immer mehr Freundinnen, schon auch ziemlich wilde Kumpels, aber engere Beziehungen eher zu Frauen. So mit Anfang 20 war ich der einzige Boy in einer Runde Frauen, die sich einmal die Woche zum “Mädchenabend” traf – Neunziger halt. So ging es weiter. Auch beruflich kam ich mit Chefinnen immer besser klar, viel später an der Humboldt Uni hatte ich eine Mentorin, ohne die ich niemals promoviert hätte. Und heute lebe ich mit zwei Frauen zusammen, was aber auch bedeutet, mein toxisches Gepräge und die Erziehung als Mann, der in den Siebzigern geboren wurde, scharf gespiegelt zu bekommen, unaufhörlich zu reflektieren und in die Kommunikation zu treten, mit den Personen, die mir etwas bedeuten. Aber auch auf meinen eigenen Körper muss ich hören. Ich habe das schon früh gespürt, obgleich ich erst viel später eine Sprache dafür fand, was natürlich mit meinem Aufwachsen zu tun hatte. Heute weiß ich: ich bin versatil und nicht-monosexuell.
Lilian: Geschichten, davon bin ich zutiefst überzeugt, werden nicht auf Papier geschrieben, sondern in Körper. Stichwort “Container”. Dort nehmen sie dann ein Eigenleben an, leben fort, versuchen, sich wiederum in weitere Körper einzuschreiben usw. Ich habe manchmal den Wunsch nach einer Art Sammelstelle, einem Ort für all diese nicht erzählten Geschichten, die doch untrennbar zur Literatur gehören, weil sie Teil des Literaturbetriebs sind, bislang aber allenfalls privat, von Einzelperson zu Einzelperson erzählt werden. Eine Deponie vielleicht, wobei “Deponie” so negativ klingt. Ein Museum? Ein Archiv? Wie sollte man einen solchen Ort nennen? Jedenfalls ist es ein Ort, an dem sich diese Geschichten ablegen, aber eben auch aufsuchen und auffinden lassen.
Alexander: Ja, das wäre schön. Ein Ort, wo die Sätze und Wörter, die irgendwer irgendwann gesagt hat und die Erfahrungen, die wiederum andere gemacht haben, für Kolleg*innen und Leser*innen verfügbar wären. Damit wir sie nicht vergessen. Damit wir uns immerzu selbst konfrontieren können mit den Willkürlichkeiten, Zumutungen und Diskriminierungen jenes sozialen Feldes, in dem wir tätig sind. Ich glaube, so ein Archiv wäre auch für die Erforschung von Produktionsverhältnissen und die Transparentmachung von Machtverhältnissen eine gute Quelle. Jüngere Autor*innen, Übersetzer*innen oder Kurator*innen wüssten so viel besser, worauf sie sich einlassen, wenn sie es mit dem Literaturbetrieb zu tun bekommen.
Lilian: Ja, es gibt einige Gründe, warum das wirklich wichtig ist. Natürlich vor allem der, den du nennst. Ich finde es beispielsweise im Nachhinein völlig absurd, welches Bild des Literaturbetriebs am Deutschen Literaturinstitut Leipzig noch 2014 vermittelt wurde. Die drei, die damals Professoren waren, hatten den Literaturbetrieb alle zu einer völlig anderen Zeit betreten und waren irgendwie auch alle ein Stück weit in dieser anderen Zeit stehen geblieben. In dieser anderen Zeit war es wohl mal so gewesen, dass man ein Manuskript an einen Verlag schickte und auch eine Antwort bekam. Und große Verlage druckten noch gern schräges Zeug, das war bis, sagen wir, ungefähr zur Jahrtausendwende so. Es gab am Literaturinstitut zu meiner Zeit dort, und so schrecklich lang ist das eben noch nicht her, so gut wie keinen Diskurs über den Betrieb, über seine Funktionsweisen oder seine Produktionsverhältnisse. Vielen wäre wohl einiges erspart geblieben, wäre ein Gespräch auch darüber schon selbstverständlicher Teil des Diskurses gewesen. Ein anderer Grund ist aber auch, dass die Geschichten erzählt werden müssen, weil man sie sich sonst vielleicht irgendwann selbst und gegenseitig nicht mehr glaubt. Manches kommt einem ja irgendwann fast zu absurd vor, um je wirklich gewesen zu sein. War das so, habe ich das wirklich erlebt? Es ist wahnsinnig wichtig, sich der Wirklichkeit zu versichern, zu vergewissern, sie zu bezeugen, im Verbund mit anderen. Schließlich steht die “Das kann ich mir nicht vorstellen”/“Das glaube ich dir nicht”/“Das denkst du dir aus”-Fraktion immer schon in den Startlöchern.
Alexander: Das kommt zusammen mit dem, wie du unser Gespräch begonnen hast. Du hast gesagt, dass das Wichtigste überhaupt Verbündete seien, ganze Netzwerke von Verbündeten, um den Mythos des Schriftstellers als einsamen Wolf endlich zu dekonstruieren, damit im Ansatz so etwas wie Solidarität im Betrieb möglich wird. Die Wolf-Metapher ist im Übrigen genauso absurd wie die Vorstellung, ein Mensch könne autonom und frei von anderen Menschen werden. Wölfe und Menschen sind Rudeltiere.
Das Anekdoten-Archiv wäre aber auch ein Ort der Zeug*innenschaft für das, was passiert in einem bestimmten sozialen Feld. Eine subjektbezogene und nicht-hierarchische Variante des Kanons vielleicht, ohne dass etwas kanonisiert, wohl aber gesammelt wird.
(c) privat
Lilian: Eigentlich könnte man sagen, es geht darum: Zu zeigen, dass das Objekt ‚Buch‘ mitsamt seiner Wirkung ein komplexes intertextuelles und intersubjektives Gewebe ist. Ob ein Text überhaupt als Buch in die Welt kommt, und wie es dann in dieser Welt ist, wie es rezipiert wird, hängt von tausend Faktoren ab, die nichts mit der Qualität des Textes zu tun haben, sondern neben vielen anderen Dingen zum Beispiel auch mit dem sozialen Betriebskapital von Verlag und Autor*in. Das In-der-Welt-Sein eines Buches ist eben gerade nicht das notwendige Ergebnis der Kreativität eines einzigen, einsamen Schöpfergottes, sondern Artefakt eines komplexen Netzwerks, so etwas wie ein Knoten vielleicht, in dem eine ganze Anzahl subjektbezogener Machenschaften kulminiert. Dass viele Leute aber immer noch glauben, dass, was gut sei, sich schon durchsetze, zeigt nur, wie fest die christliche Ideengeschichte in unseren Köpfen sitzt. “Und Gott sah, dass es gut war”. Dabei ist diese Idee heute nichts anderes als eine Kreuzung von christlichem Denken, romantischer Genie-Idee und purem Kapitalismus. Die Zeitschrift PS – Politisch Schreiben hat in ihrer sechsten Ausgabe diesen Mythos mit harter Klarheit dekonstruiert.
Alexander: Es ist ein soziales Spiel. Das Archiv würde dem gerecht werden, indem es die sozialen Kontexte und Texte eben nicht voneinander trennt. Subjekt und Objekt bleiben so aufeinander bezogen. Es kann sowieso nur offen sein, keine esoterische Sammlung an ‚Meistertexten‘. Das Anekdoten-Archiv wäre ein beständig wachsender Container für situiertes Wissen in Bezug auf Literatur und Literaturbetrieb.
Lilian: Und es geht darum, die Anekdote zu feiern. Klassischerweise wird sie ja gern abgewertet. Interessant ist die Wortbedeutung. “Anekdotos” bedeutet im Griechischen nämlich so viel wie “nicht verheiratet, nicht veröffentlicht”. Ist das nicht großartig? Wenn man das damit zusammenführt, dass historisch jegliches “weiblich” konnotierte Sprechen und die Formen, die es annimmt, als gefährlich und geschichtsbedrohend galt und deswegen verheiratet, also unter eine männliche, eindeutige Form/Haube gebracht werden musste (um im öffentlichen Raum “legal”, das heißt lesbar zu sein), dann muss man doch sagen, dass ein öffentlicher Raum für die Anekdote absolut überfällig ist. Ein Raum, durch den sie nicht schweigend hindurchhuscht, um erst mit einem angelegten Ring, im Hausinneren und hinter verschlossenen Türen wieder zu sprechen, sondern ein Raum, in dem sie, für sich allein stehend/gehend, aber mit vielen anderen verbunden, öffentlich sichtbar ist, öffentlich spricht, verweilt, verkehrt, sich vernetzt. Nicht mit genau einem Ehemann, sondern mit allen möglichen Körpern, Genres, Geschlechtern.
Alexander: Denkst du, viele Menschen würden sich überwinden, zum Beispiel in einem offenen Online-Archiv ihre Anekdoten mit anderen zu teilen? Ich glaube, die Frage ist wichtig, denn schließlich sind wir ja alle durch das System beeinflusst, das uns nahelegt, die persönlichen Erlebnisse und Befindlichkeiten gehörten eben nicht zum professionellen Bild von Autor*innen, Übersetzer*innen, Lektor*innen usw. Übrigens, die Autorin und Agentin Christine Koschmieder hat genau sowas gemacht, auf ihrer Internetseite Tacheles gesprochen. Sie hat geschrieben: “Ich möchte nachweislichen Schwachsinn nicht mehr freundlich abnicken, respektloses Vorgehen nicht mehr als Conditio sine qua non des Betriebs in Kauf nehmen, Ausflüchte und Vorwände, die systemimmanent, überlastungsimmanent sind, nicht mehr unthematisiert stehen lassen. Ich möchte nicht mehr über Umstände hinweglachen, die zum Heulen sind, und ich möchte diese Umstände nicht durch kooperatives Verhalten mittragen und verstetigen.” Darum geht’s! Die ganzen Zumutungen nicht mehr wegzuschweigen. Ich glaube, der Zeitpunkt für unser Vorhaben war nie besser.
Lilian: Ich hoffe es. Vielleicht lässt sich zur Ermutigung noch hinzufügen: Viele Dinge, die Leute im Literaturbetrieb erleben, sind ja eben nicht rein persönlich, sondern durch enorme Macht-Ungleichgewichte, fehlende soziale Kontrolle usw. immer auch systemisch.
Alexander: Dann vielleicht so: Wir laden alle Menschen, die mit uns zusammen in diesem Literaturbetrieb arbeiten, ein, ihre Anekdoten zu teilen. Schreibt euch und uns Texte über die sozialen und literarischen Verhältnisse eurer Gegenwart, schreibt über Diskriminierungen, Mikroaggressionen, über Willkürlichkeiten, Zumutungen und schiefe Machtverhältnisse. Schreibt traurige Anekdoten, amüsante Anekdoten, nachdenkliche Anekdoten, mitreißende Anekdoten, sinnliche Anekdoten, analytische Anekdoten. Tut euch was Gutes! Schreibt nicht über eure persönlichen Grenzen hinweg, tastet euch voran! Schreibt Anekdoten, die euch empowern!
Wenn ihr selber Anekdoten schreiben wollt, findet ihr den Link zum Anekdotenarchiv auf Alexanders Homepage.
Zu Teil 1 des Gesprächs geht es hier.
Zu Teil 2 hier.
Alexander Graeff (c) Natalja Reich
Alexander Graeff ist Schriftsteller und Philosoph. Er arbeitet auch als Literaturvermittler und Dozent im diskriminierungs-kritischen, interreligiös-weltanschaulichen Dialog. Er schreibt Lyrik und Prosa sowie philosophische und literatursoziologische Essays, u. a. für die Frankfurter Rundschau. Er ist Leiter des Programmbereichs Literatur im Berliner Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik sowie Initiator der Lesereihe »Schreiben gegen die Norm(en)?«. In der Queer Media Society engagiert er sich für mehr Sichtbarkeit queerer Personen und Stoffe im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Er lebt in Berlin und Greifswald. Aktuelle Veröffentlichungen sind »QUEER« (Essay, Verlagshaus Berlin, 2022) und »Diese bessere Hälfte« (Erzählung, Herzstückverlag, 2023).
Lilian Peter (c) Achim Lengerer
Lilian Peter ist Schriftstellerin, Philosophin und Übersetzerin. 2017 erhielt sie den Edit Essaypreis, es folgten Stipendien der Villa Kamogawa in Kyoto/Japan, des Künstlerhaus Edenkoben sowie des Berliner Senats. Über die gesamte Pandemie-Zeit hinweg lief ein Briefwechsel mit der japanischen Schriftstellerin Yui Tanizaki, die Texte wurden von Literaturübersetzerinnen laufend jeweils ins Deutsche bzw. Japanische übersetzt (nachlesbar auf der Webseite der Villa Kamogawa). Im Wintersemester 23/24 Gastdozentur am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ihr aktuelles Buch »Mutter geht aus«, ein Band mit poetischen Essays, die sich auf erzählerische, vielfach verschachtelte Weisen mit Fragen des Erinnerns, Erzählens, Reisens und damit zusammenhängenden Zuschreibungen an weiblich gelesene (Text-)Körper beschäftigen, erschien im März 2022 bei diaphanes.